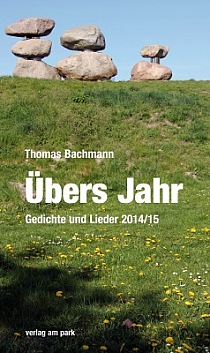Neuer Sammelband des Leipzigers Thomas Bachmann, diesmal als Verfasser
Lyrik zur Zeit des Scharfgerichts fürs Denken
Die Rezensenten sind gewarnt. Dutzendmal schreckt sie eine Henkersmaske, die aus dem Lyrikband „Übers Jahr. Gedichte und Lieder 2014/15“ hervorblickt. Doch Verriss mit Todesmut kommt mir ohnehin nicht in den Sinn. Illustrator Reiner Kamp droht auch keineswegs: Mit makaber-witzigem Zeitbezug verdeutlicht sein sparsamer Strich die Atmosphäre, in der sage und schreibe achtzig Texte Thomas Bachmanns entstanden.
Der aus Grimmen unweit der Ostsee stammende Mitbegründer des Leipziger Literaturkreises hatte parallel zum eigenen schriftstellerischen, musikalischen, grafischen und fotografischen Schaffen vier Bände mit politischer Lyrik anderer Zeitgenossen zusammengestellt eine nicht genug zu rühmende Großtat der Beharrlichkeit! Das Auseinandersetzen mit eingereichten Arbeiten, das nicht immer nur Freundschaften stiftet, schulte das Urteil. So überrascht es nicht, dass sich der Herausgeber nun selbstbewusst aufs Feld poetischer Kompositionsformen und Tonarten wagt.
„Übers Jahr“ das bedeutet: im Gang der Jahreszeiten. Es bedeutet aber auch (wie ein Essaytitel): Nachdenken über das Jahr. Vorweg sei gesagt: Bachmann spürt einen schmerzhaften Einschnitt im Leben der zerissenenen Gesellschaft.
Zum Auftakt blicken wir ins Persönlichste. Schöne Liebesgedichte fanden Eingang ins Jahresbuch; das kürzeste fragt: „Was machst du“: „so weit weg / ich entzünde eine Kerze / und stell sie ins Fenster / für dich und deinen Weg / wie vor alten Zeiten / in dunklen Nächten / dies Licht, sehr weich / und alt und ewig“.
Anders klingt die Offenbarung, von jeder Frau bleibe etwas zurück: „von jeder liebe / und als müsste das so sein / hat noch jede dieses so gehalten / als wär die narbe nicht genug / sinds von der einen fotos / von der andren schuh für mich / und von dieser hier / wirds auch was sein, ich kann / mich nicht erinnern, beim gehen / ein solches pfand in einem flur / vergessen zu haben“.
Gern spielt der Bärtige den erfahrenen Mann (mal tja, mal nana!), der übrigens nicht nörgelt, wenn er bei Sonnenaufgang appetitlich geweckt wird: „schau einfach hoch, sagst du / nichts schweres hat der himmel / und sitzt nackt auf der fensterbank / und kaust an einer semmel“.
Unter den Beziehungsgedichten berührt besonders das dem Vater gewidmete: „als du gingst ohne Wiederkehr / sah ich den Tod kommen / deine Augen so groß / wie die eines Kinds / auch deinen Zorn / werd ich nicht vergessen / die Nacht lag schwer / und hatte ihr End / mit dir in der Früh / im ersten Sommermorgengrauen / ging ich schwerfüßig / der Trauer entgegen / die wartend auf der Veranda stand / nahm sie bei der Hand / die Schwester, die dunkle / ich werd, sagte sie/ dich jetzt manchmal besuchen / ist gut, sagte ich / sei Gast mir und Weh“. Vaters Zorn (worüber?) hakt sich fest; das Bild der Trauer als Schwester hat Kraft.
Bachmann liegt Elegisches. Wenn „der Wind vorm nächtlichen Fenster“ nach Salz und Erinnerung riecht, fragt er sich: „Was Bruder sagst du mir mit all deiner Härte / der sanften, mir in die Nacht ohne Mond /samt aller vergessenen Sterne“ ihm, der „einst ging, die See im Rücken mit halbem Gruß“ Schwermütig die Elegie für Volker Braun, wenn sie schließt: „Wie letzte Pfützen sind wir so / vergessen und uns selbst vergessend / winzge Meere irgendwo / in alten Zimmern, altem Licht“. (Ein Windstoß Brauns Internationaler Argava-Preis für Dichtkunst 2015; nun sind selbst einige seiner neusten Gedichte arabisch zu lesen.)
Nachdenken über die Zeit klingt an. Unter dem bitteren Kommentar „Vergessen“ schlägt sie mit einer Erinnerung förmlich ein:
die mütter auf den feldern
im frost und
hinterm horizont der feind
als dumpfe dunkle wolke
die söhne irgendwo, die väter
niemand grub kartoffeln
wie die frauen neben wagen
im blassen wintertag
Nur scheinbar entfernt sich ein Bänkelgesang vom Thema: Karl wäscht seinen Benz, Meier kommt mit Nero, man grüßt sich, Nero hebt Bein, Benz wird nass: „Meier grinst, und Karl der schweigt / kreuzt die Arme vor der Brust / ach der Bürger zu schnell neigt / von der Fröhlichkeit zum Frust / So denn eins das andre gibt / und vom Wort geht es zur Tat / wer es gut cholerisch liebt / hat mehr als ein Wort parat / Und mit Fleiß wird nun gebläut / je dem andern das Gesicht / wer nun leise lacht der scheut / die Moral von der Geschicht“.
Erst recht nicht zum Lachen ist ein Zwischenbefund: „wir sind dabei / grandios zu verlieren / zu allererst uns / dann kommt der rest // wir stehen verwirrt / auf schwankendem boden / als triebe ein schiff / leck auf der see // wir halten einander / nicht mal bei den händen / wie kinder es tun / uns fehlt selbst das // wir stehen stumm / beschaun uns im spiegel / und können nicht fassen / was er uns zeigt“.
Schlag auf Schlag, mal zärtlich, mal derb, formt sich das Jahresgesicht. Frühlingsverse enden auf Heine-Weise: „und alte damen putzen fenster / verrückt, wie sie die sonne spiegeln / verrückt, sich vorzustellen / auf all das fiele brüllendes metall“. Ein Brief beginnt: „ich bin einen schnellen tod gestorben / tja mutter, so schnell ist vielleicht nicht ganz schlecht / er kam den blauen Himmel entlang / man sahs vorher nicht, sag nicht: gott sei dank“; die vorletzte Strophe lautet: „das jahr zeigt auf ende, das jahr zeigt auf schluss / tja mutter, der himmel wurde zum knecht / und klingt das wie früher und klingt wie lang her / so stimmt das nicht mehr, so stimmt das nicht mehr“. Man denkt an Fontane und Dschalalabad.
Schließlich das wort:
… es fühlt sich an wie krieg
großmutter, was sagst du für sachen
und in deinen augen die seltsame nacht
die wir so gerne vergaßen
heute am tisch legst du das wort
wie einen stein auf die teller
es klirrt etwas und wiegt auch schwer
ach könnte der herbst das fortblasen
In einem der stärksten Gedichte des Bandes steht ungenannt der Krieg in der Ukraine im Hintergrund. Andere Verse lassen an Grauen südlicher Gestade denken: „in der Ferne, sehr weit weg / verklingt ein Martinshorn / als fliehe es grad / in den Horizont / irgendwo schlägt raue See / auf weichen Sand, so hält er / keine Spuren / es ist still, die Ferne brüllt / wer außer uns hat Jahre die / man zählen kann wie Linsen oder / Töne oder falsch gesagte Worte / das Martinshorn verklingt / irgendjemand wird wohl sterben / in dieser Nacht mit Wind“.
Das Gedicht lebt vom poetischen Geheimnis. Sehr direkt hingegen „Leipzig 2015“: „Es wird rauer im Land / man macht hier und dort / nicht mehr so viel Worte / in seltsamer Eintracht / Helme und Steine / und Pfeffer als Würze / und Tränengas, es ist / so könnte man sagen / Blut auf der Straße / irgendwie schlüssig / nicht wahr? Wie geborstene / Scheiben, und Polizisten / rennen in Schwarz fast / amerikanisch hinter Visieren / verkniffene Münder / kurz sind die Wege geworden / und selbst Fotografen / wirds schon zu viel, der / Fall in diesen zu gut / bekannten, unruhig / machenden Zustand.“
Der ein Scharfgericht fürs Denken ist. Und in dem zum Glück dieser eine Moment bleibt: „immer wieder / wenn das getös / vorbeirauscht / und der blick / tatsächlich aus dem / fenster geht / und stille hat / als lücke zwischen / den bildern / die alles auf die / kippe stellt, dieser eine / wirkliche moment.“
Thomas Bachmann: Übers Jahr. Gedichte und Lieder 2014/2015